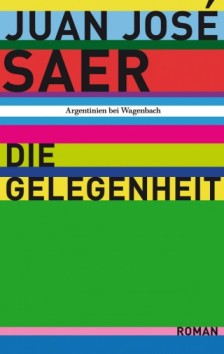Eine Stöckchengeschichte, zugeschoben von Danares
Welches Buch liest Du momentan?
Ich bin ein miserabler Leser. Ich fange ein Buch an, lasse es liegen, beginne das nächste, vergesse es, greife nach dem dritten, lege es nach ein paar Seiten auf den Stapel, ziehe das erste unten wieder hervor, nur um dann doch ein viertes in die Hand zu nehmen. Im Grunde geht das endlos so weiter. Habe ich sechs oder zwölf Monate gar nicht in einem Buch gelesen, wandert es wieder ins Regal, bis zum nächsten Versuch. Das ist der einzige Grund, weshalb die Stapel nicht irgendwann umfallen.
Innerhalb der letzten vier Wochen habe ich, so scheint mir, in acht Büchern gelesen, die ich noch nicht zu Ende gebracht oder aber aussortiert habe. (Bücher oder Manuskripte, die ich aus rein beruflichen Gründen lese, sind ausgenommen.) Einige davon sind schon seit Jahren in meinem Besitz, nur zwei der acht habe ich mir selbst innerhalb des letzten Quartals gekauft. Wer sich je gefragt haben sollte, weshalb zeilentiger liest kesselleben niemals ein Literaturblog sein könnte, hat hier ein paar Gründe parat.
Warum liest Du das Buch? Was magst Du daran?
Ivan Vladislavić, „Johannesburg. Insel aus Zufall“ (A1 Verlag 2008). Keine Neuerscheinung mehr, trotzdem eine Bestellung von der letzten Frankfurter Buchmesse. Ein Stadt- und Alltagsporträt, was ich als Genre gerne mag, wenn die Ausführung stimmt. Die von Vladislavić tut es.
Ariel Dorfman, „La muerte y la doncella“ aus Reclams roter Reihe Fremdsprachentexte mit Worterklärungen unter jeder Seite. Die benötige ich auch. Und nein, bislang haut mich das Bühnenstück nicht von den Socken. Weil ich zu wenig von dem Spanisch verstehe? Die Verfilmung von Roman Polanski habe ich übrigens noch nicht gesehen. Ich hatte mir irgendwann einmal vorgenommen, zuerst das Buch zu lesen.
Franz Innerhofer, „Schattseite“ (Suhrkamp 1979), der Nachfolgeroman des Erstlings „Schöne Tage“, die kompromisslose Aufarbeitung einer Kindheit auf einem Salzburger Bauernhof – in einem vollkommen rohen Milieu, an dem der junge Innerhofer in den 50er Jahren schier zugrundegegangen wäre. Ein sehr beeindruckender literarischer Befreiungsakt. Dass Innerhofer später trotzdem dem Suff und schlussendlich dem Suizid erlegen ist, verwundert nach der Lektüre trotzdem nicht.
Rabindranath Tagore, „Der Gärtner“ (Kurt Wolff Verlag 1921). Irgendwie ist mir der alte Tagore ja sympathisch, aber mal ehrlich, seine „Liebes- und Lebensgedichte“ treffen dann doch einfach keinen elementaren Nerv. Nicht hier, nicht heute. Am besten gefällt mir an der Ausgabe der Geruch des alten Papiers – wie ein Hauch von Bourbonvanille.
Martin Schäuble, „Zwischen den Grenzen. Zu Fuß durch Israel und Palästina“ (Hanser 2013). Ein Spontankauf im Stuttgarter Literaturhaus. Ich liebe Reisebücher, ich interessiere mich für den Nahen Osten, ich schätze schön gestaltete Hardcover. All das rettet das Buch trotzdem nicht. Schäuble kommt mir bisher als ziemlich fader Möchtegern-Büscher vor, eine Hohlmenschreportage. Eigentlich würde ich ja gerne mal wieder eine Neuerscheinung auf dem Blog über den grünen Klee loben, aber mit diesem Buch wird das nichts, fürchte ich.
Peter Fleming, „Brasilianische Abenteuer“ (Rowohlt 1958). Ein Weihnachtsgeschenk von unerwarteter Seite. Wieder ein Reise-, genauer ein Expeditionsbericht – in dem es im Übrigen um das Schicksal genau jenes Colonel Fawcetts geht, dem der Berenberg Verlag 2013 eine Neuerscheinung widmete – aus der Feder eines echten Briten. „Es gibt, nehme ich an, solche Expeditionen und solche. Ich muß sagen, daß es während dieser sechs Wochen in London so aussah, als würde sich die unsere in keine der beiden Kategorien einordnen lassen.“
Anita Moorjani, „Heilung im Licht. Wie ich durch eine Nahtoderfahrung den Krebs besiegte und neu geboren wurde“ (Arkana 2012) ist, wie soll ich sagen, eines jener gewissen Weihnachtsgeschenke eines Menschen, der es nur ganz und gar gut mit einem meint. Immerhin muss ich zur Rettung des Buches anführen, dass ich gestern einen Satz darin gefunden hatte, der mir wichtig genug erschien, aufzustehen und ihn mehrmals laut aufzusagen. Und bin ansonsten nur aus tiefstem Herzen dankbar, dass es keinen aktuellen biographischen Anlass gibt, mich derzeit an dem Thema Krebs abzuarbeiten.
Reza Haidari Kahkesh und Babak Haidari Kahkesh, „Gaumenfreuden aus Persien“ (Regura Verlag 2004), ein sehr hübsches, sehr sympathisches und sehr brauchbares persisches Kochbuch. Die einzige Zweitlektüre unter den genannten Büchern, da ich demnächst wieder einmal Gäste persisch bekochen möchte. Erst recht nach einem Besuch vor ein paar Tagen in einem entsprechenden Restaurant vor Ort, der uns alle überaus unbefriedigt gelassen hat. Da kann man unter der Anleitung der beiden Haidari-Brüder selber wirklich Besseres leisten.
Wurde Dir als Kind vorgelesen? Kannst Du Dich an eine der Geschichten erinnern?
Ja. In bester, wenn auch sehr, sehr verschwommener Erinnerung ist mir, wie unser Vater der ganzen Familie die Tarzan-Romane von Edgar Rice Burroughs vorgelesen hatte. Aus Ausgaben, die er von seinem Vater hatte, noch in Frakturschrift. – Weil ehrlichgesagt auf diese Frage den „Kleinen Hobbit“ genannt hatte: Das ist das Buch, das ich selbst bereits am häufigsten vorgelesen habe, das mein Bruder gerade eben seinen Kindern vorgelesen hat und das selbst nochmals vorzulesen ich hoffentlich noch Gelegenheiten in meinem Leben bekommen werde.
In welchem Buch würdest Du gern leben wollen?
Ich würde gerne Jorkens für seine Lügengeschichten im Club einen Drink spendieren (Lord Dunsany, „Jorkens borgt sich einen Whisky“), mit munteren Freunden die Themse hinabrudern (Jerome K. Jerome, „Drei Mann in einem Boot“), John Steinbeck auf seiner „Reise mit Charley“ quer durchs Land begleiten, mit Ray Bradbury, Tom Drury („Die Traumjäger“) oder Dan Simmons („Monde“) durch eine sommerglühende abendliche Kleinstadt spazieren und überhaupt gerne jeden Sommer genießen, dort wo sich an mehr oder weniger sorgenfreien Tagen die Schultern bronzen färben. Und ich wäre gerne H.G. Wells gewesen, wenn das als Antwort gilt.
Gibt es einen Protagonisten oder eine Protagonistin, in den/die Du mal regelrecht verliebt warst?
Juna im Netz und Danares haben recht, das ist eine Mädchenfrage. Ich würde jetzt trotzdem gerne einen Namen nennen. Aber es fällt mir leider keiner ein. Zumindest eine platonische Männerfreundschaft kann ich nennen: Ich beneide Calvin glühend um seinen Hobbes.
Welche drei Bücher würdest Du nicht mehr hergeben wollen?
Das „Handbuch für den gewitzten Stadtkrieger“ vom Barfußdoktor, um nur eines zu nennen. Obwohl, eigentlich würde ich das Buch sogar gerne und immer wieder hergeben (wenn auch nicht unbedingt mit dem blöden Cover der derzeitigen Taschenbuchausgabe, daher setze ich hier auch keinen Link). Solange ich irgendwoher ein anderes Exemplar auftreiben kann.
Ein Lieblingssatz aus einem Buch?
Es gibt ja so Bücher, die einen immer wieder regelrecht aufschreien lassen, weil da Sätze drin stehen, die … einfach zum Schreien gut sind. Leider fällt mir jetzt partout keines ein. (Da fragt man sich jetzt wahrscheinlich schon, wofür ich eigentlich lese, nicht wahr?) Also suche ich nach einem guten letzten Satz und finde das: „Ich habe nie Menschenfleisch gegessen.“ (Christian Kracht, „1979“).
Wer Spaß daran hat, darf das Stöckchen gerne aufgreifen und dabei Fragen weglassen oder hinzufügen, doch besonders neugierig wäre ich auf die Antworten von Mikkoon und Zonenmädchen. Und nein, keiner meiner Vorsätze fürs neue Jahr hat irgendetwas mit Büchern zu tun. Strandgut, Stapelbauen, Zitatevergessen – das alles wird einfach so weitergehen wie bisher.
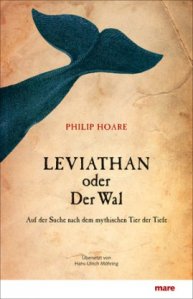 Seit 15 Jahren ist der mareverlag nicht nur Synonym für Bücher über das Meer (im konkreten wie im übertragenen Sinne), sondern auch für schöne, auch in der Ausstattung hochwertige und ansprechende Printtitel – und erfüllt alle Kriterien, um das Faszinosum (gedrucktes) Buch am Leben zu erhalten in einer Zeit, in der viele Verlage immer mehr Eingeständnisse am Printbuch machen. Frei nach Goethe darf man über den mareverlag also sagen: Hier bin ich Buch, hier darf ich‘s sein.
Seit 15 Jahren ist der mareverlag nicht nur Synonym für Bücher über das Meer (im konkreten wie im übertragenen Sinne), sondern auch für schöne, auch in der Ausstattung hochwertige und ansprechende Printtitel – und erfüllt alle Kriterien, um das Faszinosum (gedrucktes) Buch am Leben zu erhalten in einer Zeit, in der viele Verlage immer mehr Eingeständnisse am Printbuch machen. Frei nach Goethe darf man über den mareverlag also sagen: Hier bin ich Buch, hier darf ich‘s sein.